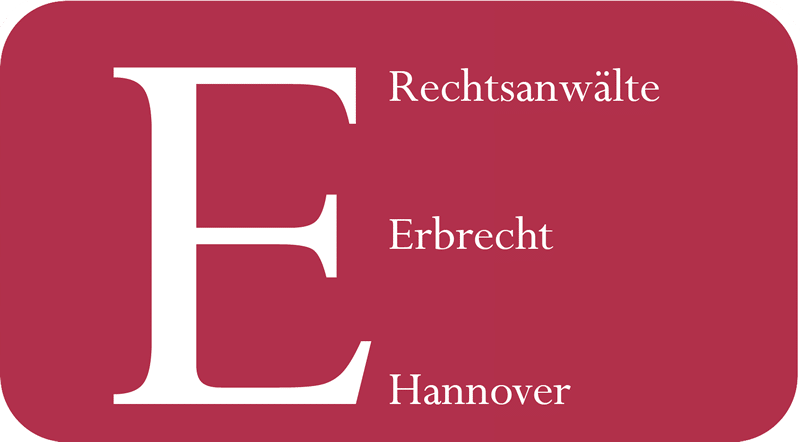Schenkung rückgängig machen
Schenken ist ein Akt der Großzügigkeit. Gründe für eine Schenkung können Liebe, Dankbarkeit oder familiäre Bindungen sein. Schenkungen spielen im privaten Umfeld eine große Rolle und sind in vielen Fällen rechtlich bindend. Die Beziehung zum Beschenkten kann sich aber auch nachträglich ändern, zerbrechen oder der Schenker gerät selbst in eine Notlage.

So kommt es in der Praxis nicht selten vor, dass Schenkende ihre Entscheidung rückgängig machen wollen oder sogar müssen. Dies kann aus persönlicher Enttäuschung oder aus rechtlicher Notwendigkeit geschehen. Eine Rückforderung oder ein Widerruf ist aber nur unter bestimmten gesetzlichen Voraussetzungen möglich.
In diesem Beitrag informiert Rechtsanwalt Sven Diel darüber, was eine Schenkung im rechtlichen Sinne ist, in welchen Fällen das Gesetz einen Widerruf oder eine Rückabwicklung zulässt und welche Fristen dabei zu beachten sind.
Inhalt
Was ist eine Schenkung?
Eine Schenkung ist rechtlich gesehen eine unentgeltliche Zuwendung, durch die sich der Schenker freiwillig verpflichtet, einem anderen etwas aus seinem Vermögen zu übertragen (§ 516 BGB). Der Schenker erwartet in der Regel keine Gegenleistung. Damit eine Schenkung wirksam ist, müssen sich beide Parteien darüber einig sein, dass es sich um eine unentgeltliche Zuwendung handelt. Damit kommt ein Schenkungsvertrag zustande, der mündlich oder schriftlich geschlossen werden kann.
Im Gegensatz zu anderen unentgeltlichen Verträgen, wie z.B. der Leihe, muss der Beschenkte das ihm überlassene Geld oder andere Sachen nicht zurückgeben und kann den Schenkungsgegenstand dauerhaft nutzen. Das geschenkte Geld oder die geschenkten Sachen gehen in das Vermögen des Beschenkten über.
Form der Schenkung
Häufig werden Schenkungen sofort vollzogen, z.B. durch die Übergabe eines Geschenkes oder die Überweisung eines Geldbetrages. Bei solchen vollzogenen Schenkungen spielt die Form der Schenkung keine Rolle. Der Schenkungsvertrag wird formlos wirksam, weil die Leistung erbracht wurde.
Wird eine Schenkung nur versprochen, z.B. für die Zukunft angekündigt, ist die Form der Schenkung nicht mehr gleichgültig. In diesem Fall spricht man von einer nicht vollzogenen Schenkung. Der Schenker macht nur ein Schenkungsversprechen, ohne dass die Schenkung sofort vollzogen wird. In diesem Fall ist das Versprechen nur wirksam, wenn es notariell beurkundet wird (§ 518 BGB).
Schenkung bereut? Wir prüfen Ihre Rückforderungsmöglichkeiten.
Ob grober Undank, finanzielle Not oder familiärer Bruch – in unserer Kanzlei in Hannover prüfen wir, ob und wie Sie eine Schenkung rechtlich rückgängig machen können.
Wichtige Merkmale einer Schenkung
Es gibt drei wichtige Merkmale, die eine Schenkung zu einer Schenkung machen. Diese sind
- Unentgeltlichkeit: Der Schenker darf keine Gegenleistung erwarten. Sobald ein Austauschverhältnis vorliegt, handelt es sich nicht mehr um eine Schenkung, sondern z.B. um einen Tausch- oder Kaufvertrag.
- Einverständnis beider Parteien: Der Beschenkte muss der Schenkung zustimmen. Dies kann ausdrücklich oder stillschweigend geschehen.
- Freiwilligkeit: Die Schenkung darf nicht unter Zwang oder Drohung erfolgen. Sollte eine Schenkung unter Androhung oder Anwendung von Zwang erfolgt sein, kann die Schenkung angefochten werden.
Warum wollen Schenkende eine Schenkung rückgängig machen?
Eine Schenkung ist mit positiven Gefühlen wie Vertrauen, Großzügigkeit und familiärem Zusammenhalt verbunden. Umso schmerzlicher kann es für den Schenker sein, wenn sich die Beziehung nach der Schenkung verändert oder belastet und das Vertrauensverhältnis im Nachhinein durch verschiedene Gründe oder Vorkommnisse zerstört wurde.
Die Gründe, warum Menschen eine Schenkung rückgängig machen wollen, sind daher fast immer emotional und persönlich motiviert:
- Enttäuschung und Vertrauensbruch: Viele Schenkende fühlen sich im Nachhinein vom Verhalten des Beschenkten enttäuscht. Vielleicht war das Geschenk als Zeichen der Anerkennung oder Verbundenheit gedacht, doch die Beziehung entwickelt sich negativ. Der Beschenkte meldet sich nicht mehr, zeigt sich undankbar oder distanziert sich plötzlich. Gerade bei Schenkungen innerhalb der Familie kann dies tief verletzen.
- Familiäre Konflikte oder Zerwürfnisse: Ein häufiger Auslöser kann ein offener Streit innerhalb der Familie sein. Kommt es zu erbitterten Auseinandersetzungen, etwa nach einer Trennung, bei Erbschaftsstreitigkeiten oder zwischen Geschwistern, zweifeln viele Schenkende im Nachhinein an ihrer Entscheidung.
- Veränderte Lebensumstände: Auch Veränderungen in den Lebensumständen des Schenkers können dazu führen, dass er die Schenkung bereut. Dies kann z.B. der Fall sein, wenn der Schenker in unerwartete finanzielle Engpässe gerät, der Wunsch nach Absicherung im Alter aufkommt und das z.B. geschenkte Geld dafür verwendet werden soll oder sich eine neue Partnerschaft oder Familienkonstellation ergeben hat. In solchen Fällen wird der ursprüngliche Wunsch, großzügig zu sein, von existenziellen Sorgen überlagert und eine Rückforderung erscheint als logischer Schritt.
- Gefühl der Ausnutzung: Manche Schenker berichten, dass sie sich im Nachhinein ausgenutzt oder manipuliert fühlen. Zum Beispiel, wenn der Beschenkte sie zu einer großzügigen Spende gedrängt hat und sich nach der Spende von ihnen abwendet. Dieses Gefühl, nur Mittel zum Zweck gewesen zu sein, wiegt oft schwer.
Nicht alle diese Motive reichen aus, um eine Schenkung rechtlich zurückfordern zu können. Sie zeigen aber, wie emotional aufgeladen das Thema Schenkung sein kann. Wenn Sie als Schenker vor allem größere Geldbeträge, ein Grundstück, eine Immobilie oder etwas von größerem Wert verschenken wollen, sollten Sie sich Ihre Entscheidung gut überlegen. Im Zweifelsfall kann es sich lohnen, gerade solche Schenkungen rechtlich und zwischenmenschlich abzusichern.
Welche rechtlichen Möglichkeiten gibt es, um eine Schenkung rückgängig zu machen?
So verständlich persönliche Motive auch sein mögen, nicht jeder persönliche Grund reicht aus, um eine Schenkung zu widerrufen. Das Gesetz kennt vor allem zwei zentrale Tatbestände, unter denen der Widerruf einer bereits vollzogenen Schenkung möglich ist: grober Undank (§ 530 BGB) und Verarmung des Schenkers (§ 528 BGB). Daneben kommen in bestimmten Fällen auch vertragliche Rücktrittsklauseln oder eine Anfechtung in Betracht.
Widerruf wegen groben Undanks – § 530 BGB
Der wohl bekannteste Grund für den Widerruf einer Schenkung ist der grobe Undank des Beschenkten. Die Vorschrift schützt den Schenker davor, dass er jemandem etwas zuwendet, der sich später in besonders schwerer Weise gegen ihn wendet. Grober Undank ist ein Verhalten des Beschenkten, das über eine bloße Kränkung oder Unhöflichkeit hinausgeht.
Grober Undank liegt vor, wenn sich der Beschenkte einer schweren Verfehlung schuldig macht, die erkennen lässt, dass er die Zuwendung in keiner Weise verdient hat. Dies kann z.B. der Fall sein bei tätlichen Angriffen auf den Schenker, bei massiven Beleidigungen, Bedrohungen oder Erniedrigungen des Schenkers oder seiner Angehörigen. Bei der Schenkung von Gesellschaftsanteilen kann grober Undank auch dann vorliegen, wenn der Beschenkte ein Konkurrenzunternehmen gründet.
Die Gerichte prüfen solche Fälle streng im Einzelfall und die Hürden für einen erfolgreichen Widerruf sind hoch. Dabei wird nicht nur der Einzelfall genau geprüft, sondern auch das Verhältnis zwischen Schenker und Beschenktem.
Der Widerruf einer Schenkung wegen groben Undanks muss innerhalb eines Jahres ab Kenntnis des groben Undanks erklärt werden (§ 532 BGB). Die Erklärung hat gegenüber dem Beschenkten zu erfolgen (§ 531 Abs. 1 BGB) und der Schenker trägt die Beweislast für das Vorliegen des groben Undanks.
Verarmung des Schenkers – § 528 BGB
Ein weiterer wichtiger Fall ist die Rückforderung einer Schenkung, weil der Schenker später nicht mehr in der Lage ist, sich selbst zu unterhalten oder seinen Unterhalt zu bestreiten. Eine Rückforderung kann auch möglich sein, wenn der Schenker seine gesetzlichen Unterhaltspflichten gegenüber seinem Ehepartner oder Ex-Ehepartner sowie weiteren Angehörigen nicht mehr bestreiten kann. Bei der Rückforderung der Schenkung wegen Verarmung des Schenkers geht es nicht um ein moralisches Fehlverhalten des Beschenkten, sondern um die finanzielle Notlage des Schenkers.
Die Regelung dient dem Schutz des Schenkers, insbesondere im Alter oder bei Krankheit. Um den Widerruf der Schenkung zu vermeiden, kann der Beschenkte dem Schenker auch die zur Sicherung seines Lebensunterhalts erforderlichen Beträge zur Verfügung stellen.
Bezieht der Schenker Sozialleistungen, können die Träger der Sozialhilfe im Wege des Forderungsübergangs (§ 528 Abs. 1 Satz 2 BGB) auf den Beschenkten zugreifen und das Geschenk zurückfordern, soweit es zur Deckung der Leistungen erforderlich ist. Da die Sozialhilfe stets nachrangig gegenüber anderen Möglichkeiten der Existenzsicherung ist, kann der Sozialhilfeträger auf das Geschenk zurückgreifen.
Hat der Schenker seine Bedürftigkeit absichtlich oder grob fahrlässig herbeigeführt, dann ist eine Rückforderung des Geschenks ausgeschlossen (§ 529 Abs. 1 BGB).
Wegfall der Geschäftsgrundlage – § 313 BGB
Eine Rückforderung des Geschenks ist auch möglich, wenn die Geschäftsgrundlage weggefallen ist. Dies ist häufig bei Geschenken der Schwiegereltern an die Schwiegerkinder der Fall. Geschäftsgrundlage ist hier, dass auch die Kinder der schenkenden Eltern von dem Geschenk profitieren sollen. Ebenso ist der Bestand der Ehe zwischen Kindern und Schwiegerkindern Geschäftsgrundlage einer solchen Schenkung, insbesondere wenn damit z.B. der Erwerb oder Bau einer Immobilie finanziert werden soll.
Anfechtung – §§ 119 ff. BGB
In bestimmten Fällen, z.B. wenn die Schenkung durch arglistige Täuschung oder Drohung (§ 123 BGB) zustande gekommen ist, kann eine Schenkung auch angefochten werden. Eine Anfechtung ist auch möglich, wenn der Schenker die Schenkung unter einem Irrtum (z.B. über den wahren Wert der Sache) vorgenommen oder versprochen hat. Für die Anfechtung gelten strenge Beweisanforderungen und feste Anfechtungsfristen.
Insolvenz des Schenkers – §§ 133, 134 InsO
Ein besonderer Anfechtungsgrund kann sich ergeben, wenn der Schenker insolvent wird. Nach § 134 InsO kann der Schenker eine unentgeltliche Leistung – z.B. eine Schenkung – anfechten, wenn zwischen Schenkung und Insolvenz weniger als 4 Jahre liegen. Wurde eine Schenkung nur vorgenommen, um mögliche Gläubiger zu benachteiligen, kann die Frist auf 10 Jahre zwischen Schenkung und Insolvenz ausgedehnt werden. Dies setzt allerdings die Kenntnis des Beschenkten von der Benachteiligungsabsicht voraus (§ 134 InsO).
Welche Fristen gelten für die Rückforderung von Schenkungen?
Wer eine Schenkung rückgängig machen will, sollte neben den rechtlichen Voraussetzungen auch die geltenden Fristen im Auge behalten. Wird eine Frist versäumt, ist der Rückforderungsanspruch in der Regel endgültig ausgeschlossen. Je nach gesetzlichem Rückforderungsgrund gelten unterschiedliche Fristen:
- Frist beim Widerruf wegen groben Undanks (§ 530 BGB): Soll eine Schenkung wegen groben Undanks widerrufen werden, gilt eine strenge Frist von einem Jahr ab Kenntnis der undankbaren Handlung (§ 532 BGB). Die Frist beginnt, sobald der Schenker sichere und vollständige Kenntnis von der Verfehlung hat.
- Frist bei Rückforderung wegen Verarmung (§ 528 BGB): Wenn der Schenker nach der Schenkung verarmt und seinen Lebensbedarf nicht mehr decken kann, hat er einen Rückforderungsanspruch. Dieser Rückforderungsanspruch ist zwar zeitlich nicht begrenzt, kann aber nur geltend gemacht werden, wenn die Verarmung tatsächlich eingetreten ist. Der Anspruch unterliegt nach Eintritt der Verarmung den allgemeinen Verjährungsfristen des BGB mit einer Regelverjährungsfrist von 3 Jahren. Diese Frist beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Schenker davon Kenntnis erlangt hat. Nach Ablauf dieses Jahres ist der Widerruf ausgeschlossen, auch wenn der grobe Undank objektiv vorlag.
- Absolute 10-Jahres-Frist (§ 529 BGB): Neben den Fristen der einzelnen Rückforderungsgründe gilt nach § 529 Abs. 1 BGB eine absolute Frist von 10 Jahren seit der Leistung der Schenkung. Nach Ablauf dieser Frist kann der Schenker sein Geschenk nicht mehr zurückfordern.
- Frist zur Anfechtung der Schenkung (§§ 119 ff. BGB): Soll die Schenkung angefochten werden, gelten die strengen Regeln und Fristen der Anfechtung. Beruht die Anfechtung auf einem Irrtum (§ 119 BGB), muss die Anfechtung unverzüglich, d.h. ohne schuldhaftes Zögern, nach Entdeckung des Irrtums erklärt werden. Etwas anderes gilt bei arglistiger Täuschung oder Drohung (§ 123 BGB). Bei arglistiger Täuschung hat der Schenker ein Jahr ab Entdeckung der Täuschung Zeit, bei Drohung ein Jahr ab Wegfall der Zwangslage.
Kann man auch Pflicht- und Anstandsschenkungen zurückfordern?
Pflicht- und Anstandsschenkungen sind Sonderformen der Schenkung. Sie beruhen nicht auf einer rechtlichen Verpflichtung, sondern auf sozialen, moralischen oder sittlichen Erwartungen. Es handelt sich also um Schenkungen, die nach den Gepflogenheiten des gesellschaftlichen Lebens als angemessen oder üblich gelten.
- Pflichtschenkungen ergeben sich aus familiären oder sozialen Bindungen, bei denen eine Schenkung erwartet wird oder üblich ist. Der Schenkende fühlt sich moralisch verpflichtet, etwas zu geben, obwohl keine rechtliche Verpflichtung besteht. Beispiele sind Weihnachts- oder Geburtstagsgeschenke an Kinder, Enkel oder enge Freunde oder Geldgeschenke zu besonderen Anlässen (z.B. Hochzeit des Kindes).
- Anstandsgeschenke sind kleinere Geschenke, die aus Höflichkeit, Dankbarkeit oder sozialem Anstand gemacht werden. Sie dienen der Einhaltung gesellschaftlicher Konventionen. Beispiele sind Trinkgelder, kleine Aufmerksamkeiten für Pflegepersonal, Lehrer oder Nachbarn, Blumen oder Pralinen bei Einladungen.
Pflicht- und Anstandsschenkungen können nicht wegen groben Undanks oder Verarmung des Schenkers widerrufen werden (§ 534 BGB). Entspricht ein Geschenk nur zum Teil einer Pflicht- und Anstandsschenkung, so kann der die Pflicht- und Anstandsschenkung übersteigende Teil dennoch widerrufen werden. War eine Pflicht- und Anstandsschenkung unteilbar, so hat der Beschenkte Wertersatz zu leisten, soweit der Widerruf zulässig ist.
Was passiert mit der Schenkungsteuer, wenn eine Schenkung widerrufen wird?
Schenkungen unterliegen in Deutschland der Schenkungsteuer, soweit innerhalb von 10 Jahren der jeweilige Freibetrag überschritten wird. Der Freibetrag ist abhängig vom Verwandtschaftsverhältnis zwischen Beschenktem und Schenker (zwischen 20.000 und 500.000 Euro). Hat der Beschenkte Schenkungsteuer gezahlt und widerruft der Schenker die Schenkung, so erlischt die Schenkungsteuer mit Wirkung für die Vergangenheit (§ 29 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG). Der Widerruf muss auf einem Rückforderungsanspruch beruhen. Bei freiwillig zurückgegebenen Schenkungen erlischt die Schenkungsteuerpflicht nicht.
Fazit
- Was ist eine Schenkung: Eine Schenkung ist eine freiwillige, unentgeltliche Zuwendung, durch die der Schenker einem anderen etwas auf Dauer – ohne Gegenleistung – überlässt (§ 516 BGB). Sie kann formlos erfolgen, wenn sie sofort vollzogen wird. Ein bloßes Versprechen bedarf der notariellen Beurkundung (§ 518 BGB).
- Persönliche Gründe für die Rückforderung: Viele Schenker möchten ihr Geschenk aus emotionalen Gründen zurückfordern, z.B. wegen Enttäuschung, Vertrauensbruch, Familienstreitigkeiten oder eigener finanzieller Not. Diese Motive allein reichen jedoch nicht immer aus, um eine rechtlich wirksame Rückforderung zu begründen.
- Gesetzliche Widerrufsgründe: Eine Schenkung kann nur in bestimmten Fällen rechtlich rückgängig gemacht werden. Dies sind grober Undank des Beschenkten (§ 530 BGB), Verarmung des Schenkers, wenn dieser seinen Unterhalt nicht mehr bestreiten kann (§ 528 BGB) oder Wegfall der Geschäftsgrundlage, z.B. bei Trennung nach einer Eheschenkung (§ 313 BGB).
- Wichtige Fristen: Bei einem Widerruf wegen groben Undanks muss die Schenkung innerhalb eines Jahres ab Kenntnis der undankbaren Handlung widerrufen werden (§ 532 BGB). Im Falle der Verarmung des Schenkers gibt es keine feste Frist, es gilt jedoch die dreijährige Verjährungsfrist ab Kenntnis des Schenkers von seiner Bedürftigkeit und dem Rückforderungsanspruch sowie eine absolute Ausschlussfrist von zehn Jahren ab der Schenkung (§ 529 BGB). Danach ist eine Rückforderung nicht mehr möglich.
- Keine Rückforderung bei Pflicht- und Anstandsschenkungen: Zuwendungen aus Anstand oder familiärer Pflicht (z.B. Geburtstagsgeld, Trinkgeld) können weder bei Undank noch bei Verarmung zurückgefordert werden (§ 534 BGB).
- Schenkungsteuer bei Widerruf: Wird eine Schenkung rechtswirksam widerrufen, entfällt die Schenkungsteuer rückwirkend (§ 29 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG). Bei bloß freiwilliger Rückgabe bleibt die Schenkungsteuer bestehen.